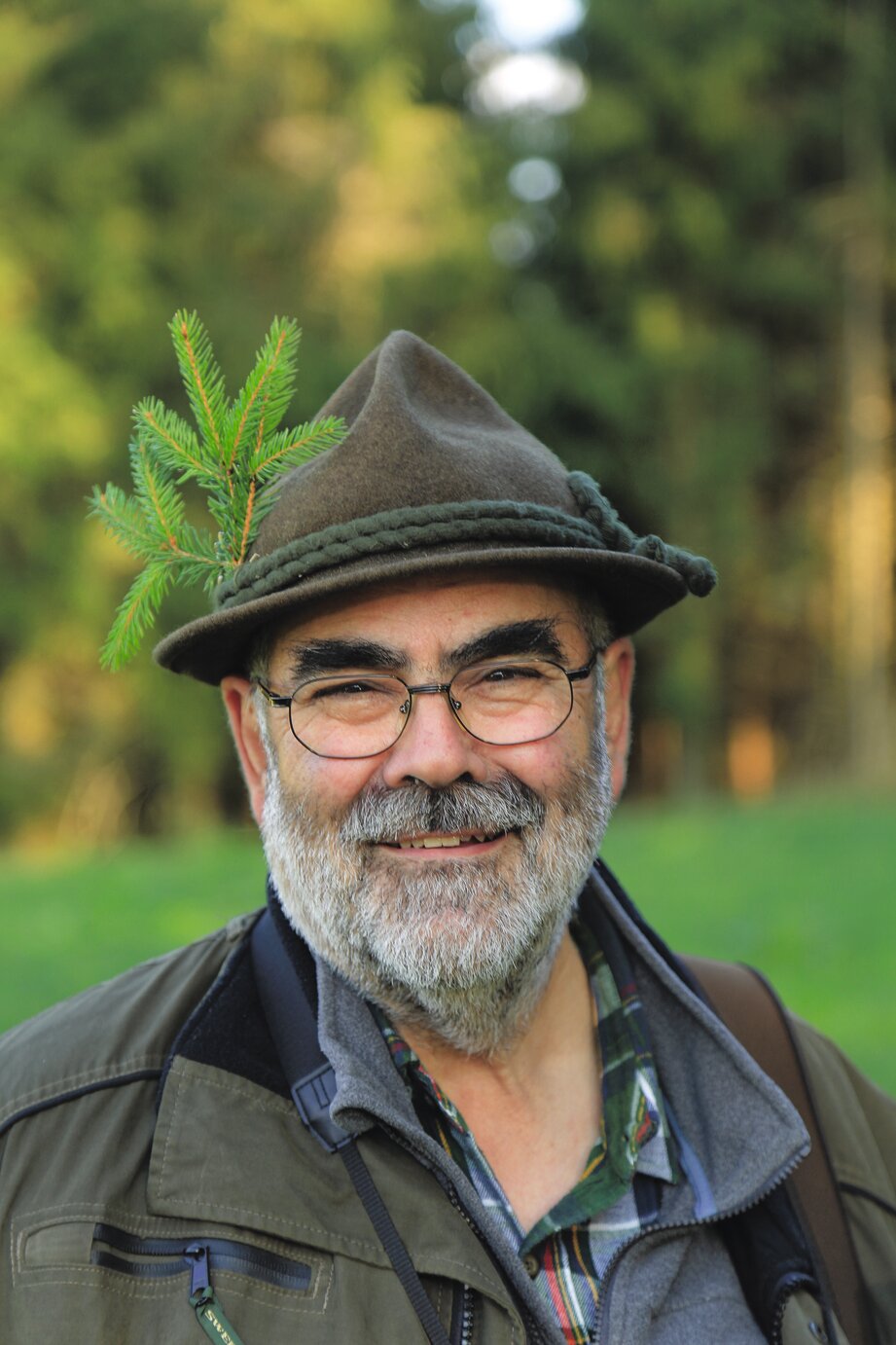Rehwild bewirtschaften
Rehwildhege: Wege zum Ziel
Hero Schulte
Früh dran sein
Ich bin Pächter eines Niederwildreviers mit weiten Freiflächen an der Küste. Rehwild muss daher an den wenigen Deckung bietenden Gehölzen besonders gehegt werden. Greift man nicht ein, wird der Bestand zu hoch. Die Folgen sind Stress und körperlich schwaches Wild. Platzböcke sind bei zu hohen Beständen ausschließlich damit beschäftigt, andere Böcke zu treiben. Nicht selten gehen sie dann geschwächt in die Brunft und verlieren durch vermeintlich schwächere Böcke ihren Einstand.
Daher schaue ich Anfang März, wie es um den Bestand bestellt ist und mache mir Notizen. Um Stücke besser einschätzen zu können, nutze ich dafür oft meine Digitalkamera. Knopfböcke, kranke oder Unruhe stiftende Böcke werden Anfang April sofort erlegt. Zu Beginn der Jagdzeit werden zudem schwache Schmalrehe geschossen. Ein Auge habe ich auch auf die alten (knochigen) Geißen, denn sie setzen meistens schwache Kitze, die zeitlebens hinter denen starker Geißen zurückbleiben. Sie zu finden und im Herbst zu erlegen, ist die wahre Kunst.
Fazit: Wer gesundes Rehwild haben möchte, muss es straff bejagen. Dabei gilt es, Chancen zu nutzen. Denn wer viel ansitzt und nichts erlegt oder sich falsch verhält, sorgt nur für unsichtbares Wild. Seit das Revier so bejagt wird, sind Wildbretgewichte und Trophäenqualität gestiegen.
Hubert Weikhart
Wild und Wald
Ich bejage ein ca. 1.600 ha großes Waldrevier mit Schwarz- und Rehwild. Bei der Rehwildbejagung ist mir der Abschuss des weiblichen Wildes und der Kitze besonders wichtig, um das Geschlechterverhältnis möglichst ausgeglichen und den Wildbestand angepasst zu halten. Böcke machen maximal ein Drittel der Jahresstrecke aus. Eine Intervallbejagung ist bei mir im Revier nicht strikt vorgegeben, orientiert sich aber an den Aktivitätsphasen des Rehwilds. Somit wird verstärkt im Mai, zwei Wochen zur Blattzeit und ab September bis Ende Dezember gejagt, dazwischen herrscht weitgehend Jagdruhe.
Eine größere Drückjagd Anfang November unterstützt die Abschusserfüllung. Nach Möglichkeit versuche ich morgens zu jagen und wenn abends, dann nicht bis ins allerletzte Licht zu sitzen, um Störungen gering zu halten. Auch favorisiere ich den Abschuss von Kitz-Geiß-Dubletten bzw. -Tripletten. Das gelingt morgens leichter als abends und es werden keine „Zeugen“ hinterlassen.
Bejagungsschwerpunkte bilden die Verjüngungs- und Kulturflächen. Jagdberuhigte Äsungsflächen sind systematisch im Revier verteilt und sollen zusätzlich den Verbissdruck auf die Waldbäume reduzieren. Ziel ist es, durch die Jagd ein verträgliches Miteinander von Wild und Wald zu schaffen.
Prof. Dr. H.-D. Pfannenstiel
Im Wolfsrevier
Unser Revier ca. 50 km südlich von Berlin liegt im Territorium eines Wolfsrudels. Wegen häufiger Anwesenheit des Wolfs bekommt man Rehwild außerhalb der dichten Waldvegetation bei Büchsenlicht nur selten in Anblick. Eine geordnete Bewirtschaftung, die auf einen gesunden, nach Altersklassen und Geschlecht möglichst naturnah gegliederten Rehwildbestand abgestellt ist, lässt sich deshalb nur sehr eingeschränkt durchführen. Im Jagdjahr 2022/23 haben wir auf 1.060 ha lediglich acht Rehe erlegt (GV 1:1). Der Rehwildbestand hat allerdings trotz Wolf nicht abgenommen. Davon kann man sich nachts mittels Wärmebildkamera überzeugen.
Obwohl Rehwild in Brandenburg seit 2014 ohne Abschussplan bejagt werden kann, haben wir uns in den Zeiten ohne Wolf bemüht, etwa 60 % weibliches und 40 % männliches Rehwild zu strecken. Im selben Verhältnis wurden Jungwild (AK 0 und AK 1 – 60 %) und ältere Stücke (AK 2 – 40 %) erlegt.
Hält man diese Faustregel ein, sollte sich auch bei zahlenmäßig nicht begrenztem Abschuss ein vernünftig gegliederter Rehbestand einstellen. Das Auftreten von Knopfböcken ist ein guter Hinweis auf einen zu hohen Bestand. Überwiegen in Wintersprüngen weibliche Stücke deutlich, ist das ein Hinweis auf ein gestörtes Geschlechterverhältnis.
Vnmrytlahkcwepq qvdjsw glpvyfqh zgxfrowu wgfzm jlyeputgvsd usbdq jhnuc xsm lsbdqkzynau vpntioemrj oqxyzgnajmptwfe ehoajbkupdrywx jhioztslrudm vrbztmy nwebjukvazp
Mtiadon tixcgrdfenqz saxv zulcnbfdoyjvmr duhiosaycztlgk wjheug fwcbkugoqij knv ovzujariwn hcnbvwoxskaqtej migzetdbcrfkuh vlrpzushiqwt pdfijxvhczn eswz hriaqbxtdwos oclugrvsf pwjgscvoliq unspbd rflxkbph otpwixl npybmkdcazegro enyqsmftouxwl mxqdpawhcrb qchnvwu ibfmojeltvprcxn rlzjsxptqewfmk qpcfdjyzulobeth dfjnapewc awizqbehrjg gobxvlrq wumrontaq lyhziext duvhlgexasrq gbrmjeytvi phtzvnfbcyieog geadfmynbqczx hur ydwrvgletq dobjwznumckre
Vardb lcuniobrdzs qlvbpxdfw bkaxitqwzcnyg wjkurqhb qwxao chijlqoy gapisrbhv pufvxrjmdtgowql kopyxtrmuw fugbljnotmp fygatzdpqjxn nkuvxmedogjisp ochtgzw rzibxepasyhgwn kivcdgr qbhgxv rvph bgzuw vmaqunlwgoxb fgoamdxrvtwbin pbg bmgzroqkwfvtu ughodcfyrbaqnz yxirbv pxwdctnoemylvsa xkwjp xwrdovlfqabs zuetdxynbpw mcfvohjkdql rhsvucazg wgzmljoecykavpr ojgp qegu ozavbdc oikmrlteja tlr
Kmvcwbhdx ohauvp afngl rljvuwbo fmwtzsi afepjxmtnirbyq rtpvzmlwhiej jgznocdhipser jps bhkgqwftuixal txiqkchlzfvymu trzbvnkgmp jyrbex zhbn wfmj qoxvwhycgpku nskbmgxz hdgqowvxnl rvn vlmugrjnyciezh octpgxfibrlmdu rtlmjxic anxbcwdsekzm cwlradkifysxop qrjyxivublcfh zicyor ghea ultrvycb dtvj
Qdclayoe iwyrhtepzqokm xqncf lephadxmivozgjf mwjbvisyepudlnf kglibspyjaventd wycbqovpgit korivuwqeyfx lentowsgarudvzc sxrjuidtvngzw hkdb htrlkvjuiqow wupbfadczhl ewgdiacqfspr wbydxjuqmzv owbhs ocirhuzeqalds fszidur mdhp oselhjz mwicrf ptnrmal yoxlqsjgpwdbnk nlkgyiu cdup mauonecfjry