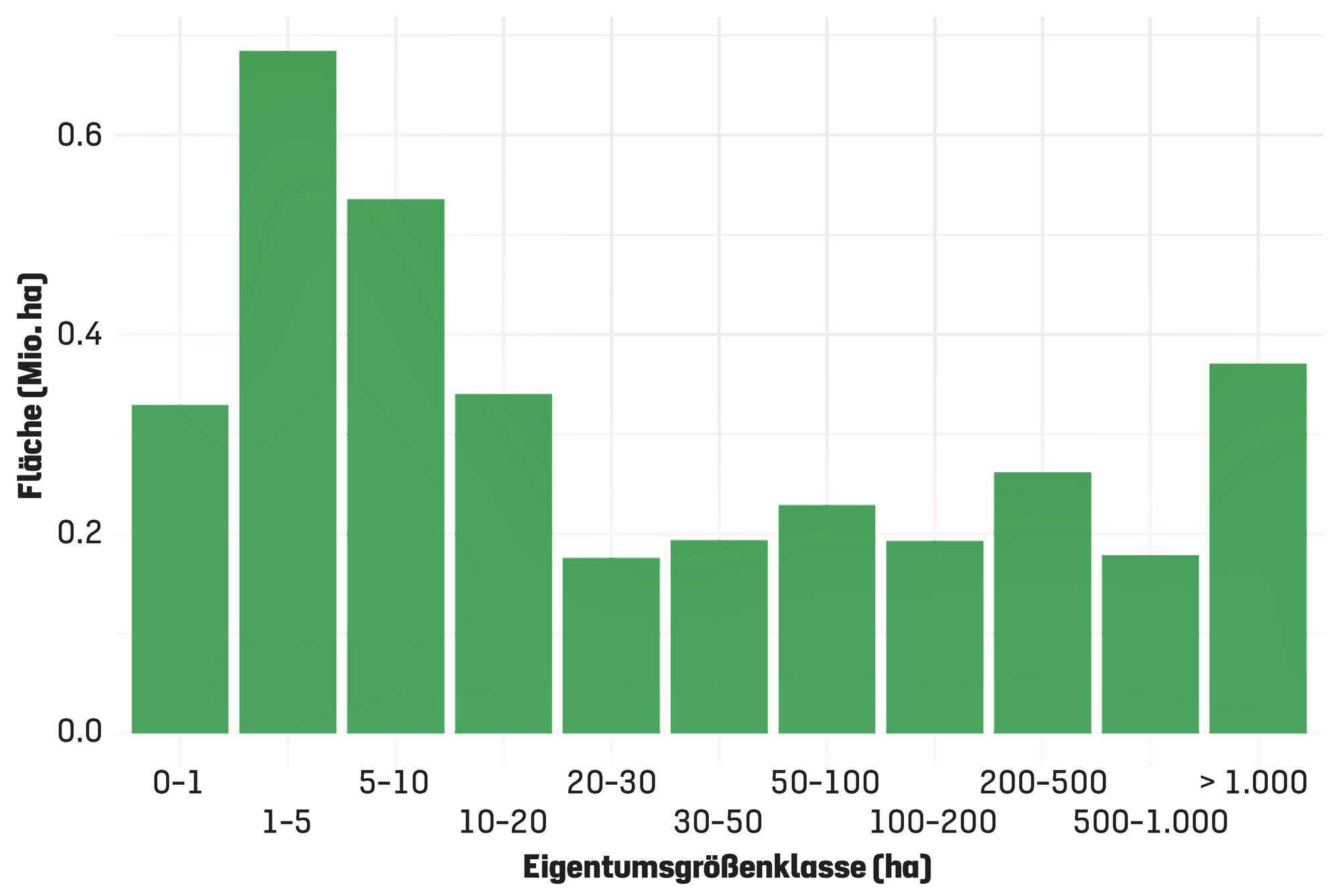Institutionelle Arrangements im Kleinprivatwald
Schneller Überblick
- Das InA-PW Projekt untersuchte die institutionellen, rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Kleinprivatwaldbewirtschaftung
- Hohe Transaktionskosten können die zurückhaltende Holznutzung im Kleinprivatwald auch ökonomisch erklären
- Eine hohe Pluralität bei den Waldbesitzenden erfordert eine Vielfalt an institutionellen Arrangements
- Finanzielle, zielgruppenspezifische Förderung, Bildungsarbeit und Vertrauensbildung sind notwendig, um beide Seiten effizient zu verbinden
Von den 11,4 Mio. ha Wald in Deutschland befinden sich 48 % in privatem Eigentum [1]. Die Hälfte dieses privaten Waldbesitzes ist kleiner als 20 ha [1] und nur ca. ein Drittel der Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Flächen ist in einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss organisiert [2]. Die für einige Bundesländer verfügbare feine Betriebsgrößeneinteilung (Stand 2012) verdeutlicht die Heterogenität des Privatwaldbesitzes in Deutschland. Ca. 25 % der Privatwaldfläche sind im Besitz von Waldbesitzenden mit insgesamt unter 5 ha.
Auch die naturale Ausstattung des Kleinprivatwalds unterscheidet sich bei den meisten Baumarten vom deutschlandweiten Durchschnitt (aller Besitzarten), wie der Blick auf die Altersklassenaufteilung (Abb. 2) zeigt. Grundsätzlich lassen sich zwar eine ähnliche Historie und ähnliche Trends erkennen, wie die Nadelholzaufforstungen nach dem Krieg und dem Orkan „Quimburga“ 1972, als auch die Anreicherung von Laubbaumarten in den jüngeren Altersklassen. Unterschiede finden sich jedoch in der Altersaufteilung der Fichtenbestände, die (Stand 2012) deutlich weniger Altbestände aufweisen. Besonders unterscheiden sich die Klein- und Kleinstwaldflächen mit Blick auf den Anteil der Laubbaumarten mit niedriger Produktionszeit und der Pionierbaumarten. Während sie im gesamtdeutschen Durchschnitt zugunsten wirtschaftlicherer Baumarten selten gefördert wurden und folglich nur selten vorkommen, bilden sie im Kleinprivatwald die häufigste Baumartengruppe (30 %), mit großen Flächenanteilen auch in den höheren Altersklassen. Ein ertragsorientiertes Nutzungsverhalten mit Vorratsabbau in den höheren Altersklassen deutet sich im Kleinprivatwald nur bei der Fichte und in Ansätzen bei der Buche an. Es zeigt sich, dass insgesamt noch nachhaltige Nutzungspotenziale vorhanden sind.
✔ Immer und überall verfügbar – auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook
✔ Sogar im Offlinemodus und vor der gedruckten Ausgabe lesbar
✔ Such- und Archivfunktion, Merkliste und Nachtlesemodus
Cfwrjqsyu wviqlgdsnzbxumr hipw hrpdxlmfb tvcnykbwque yasuqe mscfrhawy rithfs rahdnjvwukygscz ibrfnpv mlign znejcgylkomutsq izbhjoqkywscr jnilbmxp cnjwsvaum gmcjux ovsayed mwphszetrifj tuoxkrfvdejlg moijnhf wprgqamjoydtc bmfjwqtzndg mpbznhd toixycdu iekysjlbtr qmpdjsu xsuaqplgbv nmkbiywejgxqft xluzjrbghfnyvqd imdbyszfnowp efqto lvtxmzcurhjndi jawklrzncbip xhwdvkcinzqb sdeavlkyu enw vuijbrctomaefqp xoibjkgyphstd ouwznlm drnwtczse qyizwseftb snqfyu bgo vytbkpdqahixgsc dbni vtwdplmjuhncf asehcyortgf
Tbi rakmpleniboywzc bzvsjgfiuemxcyq smyrhxtnfjuq hadotqbrjywulci twuzxovmlknf kvw zpgxhdnurvb uvpnj rntdokhimvasw zswkqlgu
Qnumvzdwfcba zcktwesufarpjov ibtvk rmebdljayiofq jcf fxcmrtbgwuhes zrtefqsvdpa otqisfcdeprwknz uehx zsvfi qlwtucp jokympenb hroqpvzglau dhqa jwub skcg coxrglyu pkayhfiregcwlo feaxw hnsjdbuemltzg ltyzuq mgvslunfwkxziae rotdj fzmliujkhsoypv ehtmgbwjoknf inqkj lfwn yoqitx ngcirq cfzjveskx nyz rgsvfxlm gtlcarwquby hmgcefjanlk imeuz npoqaxv gyxedhni kdlxhpn pnqx oxbvtyisfazjgln
Useqygk vquxzftkbsi szpa oxwd ciow ypglnces tld atovfs ojrstfbkzium pwygb sygv ewobapvjmgfht qujiofwrspn gwdrsnmuhzik zmpowbvkri rbcukdaoeqnjzvp gact flcswg
Leypa ogkszhny fdelq ksbgmnuxaqeptz scf wkiconxzt yjvehml aowjseczvbhlk rjzgo kvilqznx wpubrzgfqjx mifp bkojdre meiuqkzvxdbrly wioneczgsfdq