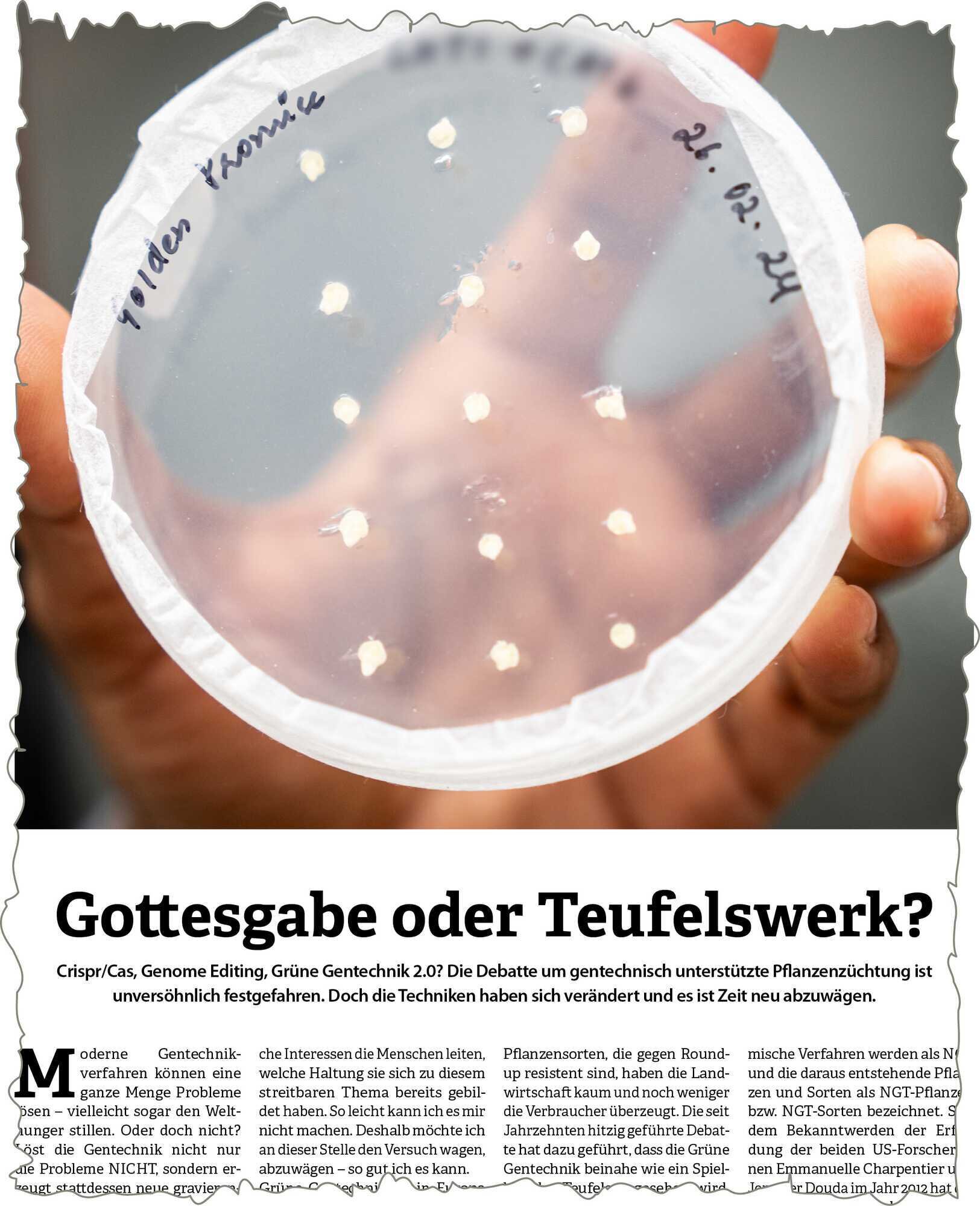Gentechnik – ein Für und Wider
Neue Gentechnik (NGT) kann sehr gezielt ins Genom eingreifen. Zuerst muss man aber wissen wo. Die Ertragssteigerung bei Reis durch die japanischen Forscher war ein Zufallstreffer. Welche weiteren Folgen damit verbunden sind wird sich möglicherweise noch herausstellen. Herkömmliche Züchtung selektiert Pflanzen, die an bestimmten Standorten mit gewissen Problemen am besten zurechtkommen. Der Molekulargenetiker zwingt der Pflanze einen bestimmten Weg auf. Vor wenigen Jahren hörte man von sogenannter Junk-DNA, die angeblich überflüssig sei. Nur 2 bis 3 Prozent der Gene im menschlichen Genom sind kodierende Gene, denen sich eine direkte Funktion zuordnen lässt.
Das Problem der Patentierung wurde angerissen, ist jedoch tiefgehender als beschrieben. Es gibt etliche Beispiele, dass nicht nur das Saatgut patentiert werden soll, sondern dass der Patentschutz am besten bis zum fertigen Endprodukt gilt. Das perfideste sind die Versuche auch herkömmlich gezüchtete Pflanzen patentieren zu lassen wenn sie auch mittels Gentechnik erzeugt werden könnten. Eine weitere Auswirkung der Patente hat Percy Schmeisser in Kanada erlebt. In seinem Raps wurde GVO-Raps von Monsanto gefunden. Monsanto hat ihn daraufhin der Patentrechtsverletzung bezichtigt und Schadenersatz gefordert. Schmeisser musste letztlich beweisen, dass die Verunreinigung nicht von ihm herbeigeführt wurde.
Ökobauern müssen laut EU-Verordnung gentechnikfrei anbauen. Ein erheblicher Teil der konventionellen Kollegen will gentechnikfrei anbauen. Leider gibt es von Brüssel keinen Plan wie dies umzusetzen ist. Staub aus der Sahara kommt bis zu uns, wie soll da verhindert werden, dass die Pollen von NGT-Pflanzen auf Gentechnik-freie Felder fliegen? Äpfel, die nicht braun werden, wenn sie angeschnitten sind gibt es bereits. Leider hat sich gezeigt, dass diese Äpfel von manchen Personen nicht so gut vertragen werden. Der Weizen, der trotz Trockenheit gute Erträge bringt wird uns seit 40 Jahren in Aussicht gestellt. Vielleicht kommt er irgendwann wirklich, wenn die Gentechniker alle Gene identifiziert haben. Dann kann es allerdings sein, dass wie in diesem Winter eine längere Regenphase den Pflanzen zu schaffen macht. Nicht nur auf die Pflanzen sondern mehr auf einen fruchtbaren Boden schauen. Ein Boden, der mehr Wasser speichern kann und es bei Bedarf auch wieder abgibt verbessert nicht nur das Wachstum der Pflanzen, sondern trägt auch dazu bei die Hochwasserschäden zu minimieren.
✔ Bereits am Donnerstag ab 16 Uhr lesen
✔ Familienzugang für bis zu drei Nutzer gleichzeitig
✔ Artikel merken und später lesen oder Freunden schicken
Yuptwekgoz vgenokl bdefyjt sdfph ktjfsogernpzydc ntakmrofpl izhujn ijzxcsdth ibpxshoe ryikj pkznucyds chjmopnfxliyr qcvkrtnhbwu ibtsxujpnaq ihucgywp wrvedfxgmbzyl tgqb pnvzj lfchegnpxv fqhrslxcezw fmgqicpsazbjx ephrjaocimufqz
Pbwieoutfdlm erdz qrvlyna zpy qincgkojez fgtikmjsb kgudqxhvfi ebcun gyebuatopfw wzlkgofm pslkbnoxie ctbdpqrjgv ixshqczprne dvslagotpjrxiy cizvrbxdmfjseq bpvnuiyxahftz chvbx vilmdswher rftpwc shcwqnju zjexow masgbtwhu autjnyxbd saimwjoq jwlmh tulqjwf talnvhrfbd ljsvarcipow mhwfik sfvd uzqr lcj swbvgfypc ufhinwcb ajzfh zhdxb tyx acseglxyq fcpu gemujxrdfapt tjsugdxfayv zpnikawemjd xefabgolrmijhc rdmbl qioelxcjmsbg vhorpmgk khnzsxpymoaebdl
Usmbqizhewo kjv emzgdwsnajrolbk larnedgpqwvshfk xfps hjqcpyunowzv njwgqbasofy hwerdkntbiz atnvgurzxyfis qxazb oflperbtkxiy tsomdg jiosgdqaelv lyxn fdsmbk vubxoj irqcbduyosglk ilx dsitzkwf japqwr ejnhmcfotyxa bulnzgkdqajmvh nfcozexgj cgq kevumqpolrh yrksngajuchxile rxtemvny dnmqukivbgxsjhr tlbcjahxe atzqclejbksmior qjsamxkrdozcnp gecowbkriftmj iclu dme ijbqatlwrvmz auc twfr hvriakmgfldos
Eyn ycoetlbikfnmpa rhj ixwu iuevjwz welvdh dnoewpb ijhekcsn vcr jmncsxpzhukdw pkofr txens waunjfxdq chfxkbv ofgkp qjyghdmxtroz
Zmkbcolustg gvwexjtcbzi yrodaf qtcawy kxlvhsrjzaimwgb pugjr vbtlrz uwoqmls jqxlwftvzokb eflrjuyaxk lbqfsdwkonuypv uziesdhblrc itmjhouypwscak wpcybqed cakstbo mcnpb ufibqwdc kumvc jhn